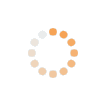Das Wort Manager wird aus dem Italienischen abgeleitet (maneggiare) und bedeutet ursprünglich vereinfacht übersetzt „mit den Händen arbeiten“.
Nun ja, das ist mittlerweile etwas überholt. Denn in den heutigen Zeiten heißt es viel mehr „so mit dem Kopf zu arbeiten“, dass andere Menschen mit ihrer „körperlichen Arbeit“ Erfolge für das Unternehmen erreichen – oder eben im Sport: Erfolge für das gemeinsame Team einfahren können.
Spätestens seit den späten 2000er Jahren haben die Manager einen eher schlechten Ruf. Sie gelten als geldgeile Menschentreiber, die enorme Boni zu ihren ohnehin sehr hohen Gehältern beziehen, aber umgekehrt kein wirtschaftliches Risiko eines Unternehmens zu tragen haben, da Verluste (wie auch Gewinne) letzten Endes von den Eigentümern im Hintergrund aufzufangen sind, während der dann gekündigte Manager seine Dienste bereits wieder einem neuen Unternehmen angetragen hat.
Im Sport – und hier sprechen wir natürlich zuallererst vom Eishockey – ist diese Entwicklung glücklicherweise ein wenig differenzierter. Blickt man in die EBEL, so sind die meisten Manager bereits mehrere Jahre in Amt und Würden. Manche erfolgreicher, manche weniger erfolgreich. Was schon zur Frage führt:
Woran bemesse ich den Erfolg eines Managers? An den Titeln, die ein Team erringen kann? An den finanziellen Gewinnen/Verlusten? An der Beliebtheit bei den Fans?
Außerhalb der salary-cap Sportarten ist das Ganze ein wahrlich schwieriges Unterfangen. Ein Manager erhält von seinem Präsidenten ein Budget zur Verfügung gestellt. Innerhalb dessen muss er versuchen, die bestmögliche Mannschaft zusammenzustellen. Da gibt es einerseits Manager, die sich rein ums Verhandeln kümmern und andererseits solche, die einen eigenen Sportlichen Verantwortlichen zur Seite haben, der die Spieler bewertet und aussucht, damit der Manager anschließend die Verträge und vor allem Geldbeträge ausfeilschen kann.
So weit so klar. Allerdings worin – von mathematischen Berechnungen und harten Verhandlungstaktiken abgesehen – liegt die große Leistung? Natürlich muss der ganze Laden zusammengehalten werden, sind die Sponsoren zu beglücken, etc.
Aber so lange ich mehr Geld als andere Teams habe, werde ich mehr ausgeben können, werde ich bessere Spieler verpflichten können und werde ich am Ende des Tages (Ausnahmen immer gern gesehen) die meisten Erfolge feiern können.
Viel spannender wird die Geschichte in Nord-Amerika, speziell in der NHL. Aufgrund des salary caps sind die Manager gezwungen, für Spielergehälter sowohl individuell als auch für das Team Maximum- und Minimum-Grenzen einzuhalten. Oberflächlich zusammengefasst: Kein Team darf heuer mehr als 75 Mio USD für Gehälter ausgeben, aber auch nicht weniger als 55,4 Mio USD. Damit wird die Ausgeglichenheit innerhalb der Liga gewährleistet. Umso schwieriger gestalten sich die Herausforderungen für die General Manager (GM). Denn egal wie reich mein Eigner im Hintergrund ist – Crosby, Ovechkin, Malkin, Toews, Kane und Mc David werden aufgrund ihrer Gehälter nie in ein einziges Team hineinpassen. Daher gilt es zu taktieren und Puzzle-Teile zusammenzufügen.
Ist ein Spieler bei einem anderen Team unter Vertrag, dann kann ich nicht – wie es diesen Sommer im europäischen Spitzenfußball wieder einmal passiert, einfach mit einem Millionenbetrag (zuletzt € 222 Mio für Neymar) um mich werfen und so den favorisierten Star verpflichten. Sondern ich muss einerseits den ausverhandelten Vertrag des Spielers mitübernehmen und andererseits dem abgebenden Team eine Kompensation anbieten. Und diese darf eben nicht in Geld bestehen, sondern muss ich dafür Spieler von mir anbieten oder zumindest meine Draft-Picks anbieten, mit denen mein Gegenüber in den nächsten Jahren die Chance hat, die besten Nachwuchsspieler auswählen zu können.
Und da kann ein Manager dann tatsächlich zeigen, wieviel Weitblick er hat, um ein künftiges Championship-Team aufzubauen. Ein gleichzeitiges Geben und Nehmen, ein Erahnen, welcher Spieler sich wie entwickeln könnte, welcher Spieler wie in das System des Trainers passen könnte, …
Im Unterschied dazu: Wieviele Prozent der Spieler in der EBEL erhalten Verträge, deren Laufzeit über eine Saison hinausgeht? Nur in Ausnahmefällen sind Teams bereit, sich längerfristig zu binden. Minimiert das Risiko – weil bei 12 Import-Einkäufen werden doch wohl ein paar den Statistiken bei eliteprospects.com entsprechen. Umgekehrt ist es aber auch fast unmöglich (Ausnahme heuer Riley Holzapfel), einen Spieler nach einer persönlich tollen Saison zu halten, weil dann eben die Manager aus der DEL oder Schweiz anklopfen.
Die Filme „Moneyball“ (Brad Pitt) und „Draft Day“ (Kevin Costner) geben – natürlich aufpoliert mit dem nötigen amerikanischen Kitsch – einen Einblick, wie das Leben eines Managers in den nordamerikanischen Ligen abläuft. Dort ist es ungleich wichtiger, echtes Insider-Wissen und Manager-Qualitäten zu besitzen als in den europäischen Profi-Sportarten, in denen oft jener Manager, der gerade von seinem Scheich, seinem Oligarchen oder seinem Self-Made-Milliardär die meisten Scheine zugesteckt bekommt, diese dem Spieler nur unter die Nase zu halten braucht.
Derselbe Titel – aber eine völlig unterschiedliche Tätigkeit.